Hallo Jenseits, ich bin online 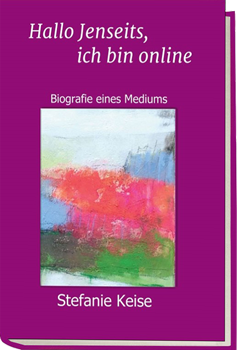
Biografie eines Mediums
Von klein auf versucht das hochsensible Mädchen Stefanie, ihre merkwürdigen Wahrnehmungen und ihre Andersartigkeit zu verbergen. Auf der quälenden Suche nach sich selbst bringt sie als rebellierende Jugendliche sich und ihre Eltern an die Grenzen. Erst als sie in England ihre künftige Schwiegermutter kennenlernt, wird Stefanie Keise überraschend offenbar, wer sie wirklich ist und wozu sie befähigt wurde. Entschlossen folgt sie ihrer Bestimmung. Leichter wird der Lebensweg durch diesen Entschluss nicht. Im Gegenteil, die Prüfungen nehmen noch einmal richtig Fahrt auf ...
> Dieses Buch direkt beim Verlag bestellen
Leseprobe "Hallo Jenseits, ich bin online"
> Diese Leseprobe als PDF laden
Einblicke
Samstagabend. Soeben habe ich die Gäste meiner Live-Demonstration verabschiedet. Regelmäßig lade ich zu dieser Veranstaltung ein und gebe durch Jenseitskontakte vor Publikum Einblicke in meine Arbeit als spirituelles Medium. Ich höre die Menschen beim Hinausgehen leise miteinander sprechen. Sie klingen beeindruckt, fassungslos, diskutieren das Erlebte. Manche sind skeptisch. Die ersten Autos werden schon gestartet. Dann fällt die Tür ein
letztes Mal ins Schloss.
Ich massiere Stirn und Schläfen und streife mir die Schuhe ab. Wenn ich vor vollen Zuschauerreihen in zwei Stunden zunächst referiere und dann Jenseitskontakte zu Verstorbenen mache, bin ich anschließend erschöpft. An manchen Abenden vor lebendigem, energetischem Publikum komme ich vor lauter sprudelnder Informationen der Verstorbenen gar nicht nach. An anderen Abenden mit eher skeptischen und verschlossenen Menschen läuft es zäher. Ich muss dann viel aus meiner Energie schöpfen, um einen atmosphärischen Fluss in Gang zu bringen und „die Leitung“ zu halten. Was ein bisschen wie Entertainment mit Verstorbenen für die Lebenden klingt, hat eine tiefe spirituelle Bedeutung. Die Aufgabe eines Mediums ist das Beweisen unserer Existenz über den Tod hinaus. Dieser Trost, dass nach dem körperlichen Sterben die befreite Seelenenergie Zeichen geben kann, hat so manchem verzweifelten Hinterbliebenen die eigene Lebensfreude wieder möglich gemacht. Es ist meine Berufung, den Menschen zu helfen. Nichts erfüllt mich mehr, als wenn ich als tiefgläubiger Mensch meinen Nächsten Hoffnung geben kann. So manche melden sich nach der Live-Demonstration noch einmal für ein weiteres intensives Einzelgespräch im Kontakt mit ihren Verstorbenen. Mithilfe meiner Geistführung empfange ich die Botschaften der Jenseitigen in Bildern, Farben, Düften, Empfindungen. Ich werde zum Empfangskanal und erzähle oft genug von kleinen Geheimnissen, die nur mein Klient und der Verstorbene wussten. Das Lächeln meines Gegenübers unter den Tränen ergreift mich immer wieder neu.
Aber Schluss mit dem Sinnieren, denke ich, denn wie immer beginnt nun das Aufräumen für mein Team und mich.
Ich öffne die Fenster für eine Stoßlüftung. Meine Freunde und Assistenten Petra, Tina und Martin plaudern in der Küche.
„War das wieder ein Andrang heute Abend, was?“, fragt Tina. „Und war die Frau mit dem verunfallten kleinen Sohn nicht besonders rührend? So gefasst, während Stefanie die Schildkröte aus Plüsch genau beschrieb, die
sein Lieblingsspielzeug war.“
„Ungewöhnlich, so eine Schildkröte“, sagt Martin etwas gepresst, weil er gerade eine Wasserkiste hochhebt.
„Ja, und damit genau der Beweis für die Mutter, dass ihr Sohn dieses Bild geschickt hat. Aber was sagt ihr denn zu dem verstorbenen Architekten, der seiner Frau aus dem Jenseits noch die schönsten Komplimente machte?“ Petra lacht, während sie Geschirr in die Spülmaschine räumt.
„Was ich dazu sage? So ein Gentleman im Jenseits ist im Zweifelsfall besser als ein Rüpel hier.“
Jetzt muss Tina auch lachen.
„Aber war das nicht witzig, als Stefanie heute Abend einfach nicht wusste, was die verstorbene Schwester der einen Zuschauerin in der Hand hielt? Dieses verzweifelte Beschreiben von irgendwelchen schwarzen, kleinen, runden
Dingern? Und die Verstorbene deutete immer auf ihren Mund? Und Stefanie sah es und machte es die ganze Zeit nach!“
Ich muss über das Geplauder schmunzeln, schließe die Fenster wieder und rücke Stühle zurecht. „Stefanie?!“
Tina lugt aus der Küche. „Wir unterhalten uns gerade über die Knöpfchen, die du erst nicht erkannt hast. Das war heute der Hammer, oder?“
Ja, war es, denn nachdem ich sagte, dass ich Lakritz im Mund schmecke, rief die Frau im Publikum: „Veilchenpastillen! Die sind es! Die hat meine Schwester so geliebt!“
Im Büro sichte ich kurz meinen Kalender für die kommende Woche. Neben den regelmäßigen Kursen noch etliche Auralesungen und zwei Berufscoachings. Mal nachrechnen, ob ich es pünktlich zum Mediationskreis schaffe. Und gleich Montagfrüh zwei Jenseitskontakte. Dafür kommt eine Klientin sogar aus Köln. Zudem Vorbereitungen für den nächsten Zertifikats-Kurs. Meine Sekretärin möchte die Homepagetexte dafür mit mir durchgehen. Ich seufze. Die Aufnahmen für die Meditationen zum Download stehen noch an, und wann war noch gleich Beginn des Tranceworkshops? Ich halte inne. Hätte ich je gedacht, als Medium in Münster so einen Erfolg zu haben? So viele Menschen vertrauen mir und suchen meinen Rat in jeglichen Lebenslagen. Dankbarkeit breitet sich in mir aus.
Viele meiner Teilnehmer oder Klienten, zu denen ich über die Jahre schon ein etwas vertrauteres Verhältnis habe, interessieren sich für meinen sogenannten Werdegang. Klar, wenn man junge Menschen nach ihren Berufswünschen fragt, wird man eine ganze Reihe von Vorstellungen hören, aber wohl kaum: „Ich denke da an eine Laufbahn als Medium. Mal schauen, ob das Arbeitsamt mir eine Ausbildung anbieten kann.“ Wie wird man also Medium? Auch die Presse wird zunehmend auf mich aufmerksam. Genug Gründe, eine Biografie zu schreiben? Vielleicht. Aber der eigentliche Grund ist ein anderer.
Dieses Buch ist eine Hommage an Gott und meine Geistführung. Jede Zeile, jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Erinnerung ist Dankbarkeit für das Vertrauen in mich und für die unglaubliche Unterstützung, die mir zuteil wurde. Indem ich meinen langen, oft sehr schweren Weg beschreibe, möchte ich Zeugnis ablegen von meinem Glauben an Gott. In seinem Sinne möchte ich mit dem Buch das tun, was ich sonst auch mache: Menschen Hoffnung geben. Ich möchte Trost spenden und heilsam sein, damit auch Sie Ihr individuelles Schicksal nicht als Willkür, sondern als Fügung verstehen und es im Vertrauen auf eine allumfassende Liebe und Sinnhaftigkeit annehmen und tragen können.
„Folge dem Ruf Deiner Seele,
sie versucht, Dich zurück
zur Einheit zu führen.“
Stefanie Keise
Kapitel 1
Als Münsteraner weiß man, wie eine Kirche aussieht. Es stehen schließlich gefühlte 100 von ihnen in der Stadt herum. Schon der ganz kleine, idealerweise katholische Münsteraner (denn das war lange Zeit von Vorteil) kennt eine beträchtliche Anzahl dieser Sakralgebäude auch von innen. Je nachdem, zu welchen Gemeinden die zu taufende, zu verheiratende oder zu beerdigende Verwandtschaft gehört. Der Kirchgang war zu meiner Zeit selbstverständlich. Die Existenz Gottes war mir von Beginn meines 1954 geborenen Lebens an immanent. Mir stellte sich die Frage des Glaubens im Wortsinn gar nicht. Ich musste nicht an ihn „glauben“. Gott war und ist einfach Teil meines Bewusstseins. Münster erwies sich als fruchtbarer Boden zur Festigung meines Glaubens. Nie habe ich an Gott gezweifelt. Die christliche Erziehung in diesem westfälischen Bischofssitz durch die katholische Familie, die sogar einen Onkel als Kaplan der bekannten Kreuzkirche aufweisen konnte, bot mir bestätigende Sicherheit.
Weil uns Gott wie im richtigen Leben auch auf den folgenden Seiten noch sehr oft begegnen wird, und weil ich mir wünsche, dass Sie und ich uns gut verstehen, möchte ich zu Anfang etwas klarstellen. Wenn ich von „Gott“ und „er“ spreche, benutze ich der Einfachheit halber die im Christentum gebräuchlichen Worte. Wir werden ohnehin nie Begriffe finden, Gott in seiner Allumfassheit zu beschreiben, geschweige denn eine treffende optische Vorstellung dessen haben, was „Gott“ ist. Aber wir Menschen brauchen eben Worte und Bilder. Weil ich der Vielfalt der Vorstellungen von Gott gerecht werden möchte, richte ich die Gebete in meinen Seminaren und Zirkeln oft an „Vater, Mutter, Schöpferkraft“. Das wäre im Folgenden denn doch etwas hinderlich. Lassen Sie uns so verbleiben: Sie gestatten mir die Bezeichnung Gott in der damit verbundenen maskulinen Form, und im Gegenzug ist es mir völlig recht, wenn Sie bei „Gott“ lieber Allah denken, an eine Natur-Urmutter, oder eine vor Liebe überbordende Lichtquelle in sich
fühlen.
Ich freue mich für jedes Kind, das Zugang zum Glauben hat, und das sich auf seinem Weg von Gott angenommen, geliebt und geschützt fühlt. Wer weiß, in welche seelische Not ich geraten wäre, hätte ich nicht diese einzige wirklich funktionierende Lebensversicherung seit jeher in mir gehabt.
Denn ich war anders. Damit meine ich in dem Sinne anders, dass ich keine entscheidende Schnittmenge mit meinen Altersgenossen fand. Bei mir funktionierte nicht, was bei anderen Kindern während des Aufwachsens passiert: dazugehören. Zum Beispiel zu der Gruppe der Mädchen, die Sinnsprüche sammeln und dieselben Bücher mögen. Da gibt es Gespräche und Gemeinsamkeiten und Abgrenzungen und sich allmählich entwickelnde Ansichten im Austausch. Von außen betrachtet wären solche Mädchen für mich passend gewesen. Aber immer dachte ich tiefer und komplexer und wunderte mich, mit wie wenig sie sich gedanklich zufriedengaben. Ich fühlte mich nie wirklich zugehörig. Mehrmals gab es für kurze Zeit in mir diese Freude, jetzt aber die vermeintlich richtigen für diese Art verschwörerisches Urverständnis unter Freundinnen gefunden zu haben. Das erwies sich bis ins Jugendalter und darüber hinaus nach kurzer Zeit als Trugschluss. Obwohl ich schon von klein auf großes Mitgefühl für Kinder empfand, die in irgendeiner Form benachteiligt waren, obwohl ich vor allem den Waisenhauskindern unseres Stadtviertels immer zu helfen versuchte und auch keineswegs unbeliebt war, blieben meine eigenen Sehnsüchte nach wahrem Verständnis und wahrem Gleichklang unerfüllt.
Meine Hauptbeschäftigung war das Beobachten. Offenbar nahm ich mit feinen Sinnen viel mehr wahr als andere – Kinder wie Erwachsene. Ich fühlte anders und dachte anders. Eine ungefilterte Informationsflut aus Bildern und Empfindungen, Zwischentönen und Ahnungen durchströmte mich, wenn Menschen um mich herum etwas erzählten oder agierten. Während ich neben dem Gesagten auch das wahrnahm, was verschwiegen wurde, jagten gleichzeitig Gedankenströme auf vielen parallelen Bahnen durch meinen Kopf. Die Summe war ein umfassendes Bild aller situativer Facetten. Selbst wenn ich es hätte in Worte fassen können, hätte ich mich wohlweislich gehütet, meinen Mitmenschen etwa an der elterlichen Kaffeetafel fröhlich plaudernd meine Erkenntnisse über ihren Seelenzustand mitzuteilen. Aber man sah es mir an. Viel später als Erwachsene hörte ich von meinem britischen Freund Paul Lambillion, dem spirituellem Heiler, Lehrer und Berater von internationalem Ruf: „Stefanie, you’ve got this X-ray-look. There’s no way to hide anything from you.” Diesen alles erfassenden Röntgenblick zu haben, erweist sich vor allem in der Schule als zweifelhaftes Vergnügen. Die meisten Lehrer empfinden solche Schüler zumindest als unbequem, manche fürchten sie. Es ist nun einmal eher unschön für einen beruflich besserwissenden Erwachsenen, unverwandt von dem Augenpaar eines kleinen Mädchens (und später einer aufmüpfigen Jugendlichen) angestarrt zu werden, dessen Blick sagt: „Was immer du hier meinst zum Besten zu geben, ich spüre deine fachliche Unsicherheit in den Details. Zudem fühle ich einen Bruch in deinem Leben, der nicht dadurch besser wird, dass du deinen Frust an der schwächeren Kollegin auslässt. Du verhältst dich unehrenhaft.“ Meine schulischen Leistungen waren aber nicht nur aufgrund dieserart provozierter Animositäten dürftig. Meine Auffassungsgabe und meine ganze Art des Denkens und allumfassenden Erlebens ließen sich nicht in die Schablonen enger Schulstrukturen und aufgezwungener Lernmethoden pressen.
Wie gönne ich den jungen Menschen von heute, dass es mittlerweile Riesenfortschritte in der Erkenntnis solcher „Dispositionen“ gibt. Heute hätte man über Klein-Stefanie von damals gesagt: „Das Kind ist hochbegabt, hochsensibel und hochsensitiv.“ Endlich ist dieses Phänomen wenigstens bekannt und schneller entdeckt. Es gibt ausgebildete Förderlehrer, die diesen Kindern mit Verständnis und Respekt begegnen. Fachliteratur und Internetforen geben diesen Menschen die Sicherheit, dass sie mit ihrer Art zu denken und zu fühlen nicht nur einfach anders normal, sondern sogar mit besonderen Begabungen ausgestattet sind. Zu meiner Zeit waren Gaben solcher Art unbekannt, unerkannt und unerwünscht. Nach dem Krieg hatte man zu funktionieren, nicht zu philosophieren. Für mich bedeutete das Irritation, Selbstzweifel, Verletzlichkeit und innere Isolation. Dass ich zudem noch Wesenheiten wahrnahm, die es offiziell in der Realität nicht gibt, trug nicht zur Besserung meines Ansehens bei. Das war mir klar, weshalb ich als Kind zwar bereits laut mit meinem langjährigen Geistführer sprach (immerhin jemand, der mich verstand), aber ihn niemandem vorstellte. Ich denke, meinem Geistführer kam das entgegen. Sicher war es auch in seinem Sinne, vor allem meine Mutter zu schonen. So enthielt ich ihr also vor, dass der unsichtbare Fantasie-Freund, mit dem ich mich ihrer Meinung nach unterhielt, ein verstorbener Ägypter war. Schon als kleines Kind hatte ich wahrgenommen, dass da jemand um mich ist und es als selbstverständlich erachtet. Anfangs merkte ich nur an der mich umgebenden wärmenden Energie, dass er sich näherte, um mir beizustehen. Mit der Zeit entwickelte sich der optische Eindruck. Ein verstorbener, fremdländischer, weiser Mann war mein Vertrauter – und mein erster Jenseitskontakt. Aber das wusste ich noch nicht.
Als einmal die ganze Familie (ich habe drei Geschwister) zusammen mit meiner Patentante einen Sonntagsspaziergang machte, hörte ich, wie sie zu meiner Mutter sagte: „Aber, Käthe, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du nicht merkst, dass Stefanie irgendwie anders ist. Die ist nicht wie wir.“ Meine Mutter reagierte abweisend und verschlossen. Sie interpretierte „anders“ als das, was sie ohnehin schon in mir sah: nicht normal. Das durfte einfach nicht sein in der Familiensituation. Sie hatte es schwer genug.
Meine Mutter wurde im westfälischen Hoetmar geboren, und was immer sie sonst noch für Vorstellungen von ihrem Leben hatte, eines wollte sie auf gar keinen Fall: einen Bauern heiraten und in der Landwirtschaft arbeiten. Obwohl mein Großvater aus einer Familie mit zwölf Kindern stammte, hatte er es geschafft, ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Meine Großmutter hatte ein Haus mit in die Ehe gebracht, und so gab es Raum für eine kleine Nährmittelhandlung. Im Laufe der Zeit bauten sie einen beachtlichen Eiergroßhandel auf, in dem meine Mutter schon früh mithalf. Die Familie war fleißig und gläubig, und meine hübsche, sportliche Mutter zog die Blicke der jungen Männer im Dorf schon früh auf sich. Sie erzählte immer von einer Voraussage einer fremden Frau, dass ihr ein blondgelockter, blauäugiger Soldat begegnen würde. Offenbar schwieg sich die Zukunftsdeutung über diejenigen Details aus, dass der junge Mann abgekämpft und arm mit einem einzigen, vor Flicken doppelt so schwerem Unterhemd eintraf. Aber da stand er – blonde Locken, blaue Augen, mein Vater.
Sein Weg hatte ihn nicht nur durch den politischen Krieg geführt, sondern auch durch einen seelischen. Als er neun Jahre alt war, entschied die zweite Frau seines Vaters, dass sie nur die jüngeren Kinder der insgesamt sechs Geschwister übernehmen wolle, die älteren hätten zu gehen. Mein Vater wurde aus seinem Geburtsort Jessen/Landkreis Wittenberg fortgeschickt. Da die Familie zu den von den evangelischen Gläubigen beargwöhnten Katholiken gehörte, sollte der Junge in ein katholisches Gebiet. So landete er bei einem Kötter in Hoetmar und vermisste seine an Schwindsucht gestorbene Mutter schmerzlich. Mit acht Jahren hatte er auf Geheiß seines Vaters hin den Arzt zur Mutter holen sollen, den er schließlich auf einer Party fand. Als mein Vater ihn um Hilfe anflehte, antwortete er brüsk: „Was soll ich bei euch? Deine Mutter wird sowieso sterben.“ Diese Großmutter, die ich nie kennenlernen durfte, war Krankenschwester in der Radiologie gewesen, gebildet, gläubig und eine feine Frau. Sie las und schrieb sehr viel und spielte Klavier. Mein Vater hatte seine hohe Intelligenz und seinen Feinsinn sicher von ihr geerbt, und nun konnte er als Neunjähriger froh sein, wenn er bei dem fremden, kinderlosen Kötterehepaar in der Nähe von Warendorf am Ofen sitzen durfte. Der Junge hatte zu arbeiten und im Stall zu schlafen. Als er später mit knapp 17 Jahren aus der Gefangenschaft zu ihnen zurückkehrte, hieß es nur schroff: „Was willst du denn hier?!“, und die Tür fiel zu. Dasselbe bittere Erlebnis hatte er vorab schon einmal gehabt, als er sich aus Sehnsucht zurück zum Vaterhaus durchschlug und vom eigenen Vater mit ähnlichen Worten zurückgewiesen worden war.
Nun aber war da ein Anker: Meine Mutter, und fast mehr noch die Mutter meiner Mutter. Für meine Großmama Maria war der Glaube kein Lippenbekenntnis. Ungeachtet dessen, was man im Dorf wohl über die Unsittlichkeit eines unverheirateten jungen Paares unter einem Dach sagen könnte, nahm sie meinen Vater in ihr Haus auf und sorgte für ihn. Nach fünf Jahren allerdings hielt auch sie es für allmählich höchste Zeit, klare Verhältnisse zu schaffen und die Liaison zu legalisieren. Meine Eltern heirateten und gingen von Hoetmar nach Münster, um sich eine Existenz aufzubauen. Im Gepäck hatten sie so gut wie nichts. Im kriegszerstörten Münster wurde den Suchenden ein leerstehendes Häuschen an der Werse, einem Fluss, zugewiesen. Vor allem für meine Mutter bedeutete das harte Zeiten. Als ich dann 1954 geboren wurde, hatte sie schon meinen zwei Jahre älteren Bruder. Ein Jahr später wurde meine Schwester geboren, und der jüngste Bruder ließ auch nur zwei weitere Jahre auf sich warten. Die Feuchtigkeit hatte jeden Winkel in dem Holzhaus am Fluss erobert. Es war klamm, modrig und die Betten schimmelten. Elektrisches Licht gab es nicht. Fast mehr noch als diese äußeren Umstände machte meiner Mutter die Einsamkeit da draußen zu schaffen. Die Ausbildung meines Vaters im Krieg zum Fahrlehrer trug nun Früchte. Er hatte Arbeit gefunden und war ganztägig fort. Das Fahrrad bot die einzige Möglichkeit, die Gegend einmal zu verlassen. Wie oft das einer Frau mit kleinen Kindern möglich war, kann sich jeder ausmalen. Meine Mutter, die in einem turbulenten großen Haushalt aufgewachsen war, litt unter der Isolation, die mit einem Gefühl der Unsicherheit einherging. Es waren immer noch viele Flüchtlinge unterwegs. Fremde Menschen fuhren auf Booten an unserer einsam gelegenen Unterkunft vorbei. Unser Hund Bella wachte in solchen Situationen an ihrer Seite. Mutters dauernde Traurigkeit stand der Flussfeuchte in nichts nach. Sie durchzog ebenfalls spürbar jeden Winkel des Häuschens.
Der Umzug in die Stadt einige Jahre später musste meiner Mutter wie eine Erlösung vorgekommen sein, und doch habe ich auch die dann folgende Zeit in einer richtigen Wohnung als trüb und grau überschattet in Erinnerung. Die Welt schien mir lieblos und jeder mit sich selbst beschäftigt. Aber woher sollten die Menschen um mich herum auch Entspanntheit und liebevolle
Leichtigkeit nehmen? Eine ganze Generation hatte damit zu tun, auf allen Ebenen und in allen Bereichen das Leben nach dem Krieg wieder in Gang zu bekommen. Eine gewisse Bedrückung, Strenge und Erschöpfung wird in den meisten ärmeren Familien normal gewesen sein. Wer den Krieg überlebt hatte, trug zumindest emotionale Narben, für deren Heilung jeder selbst zu sorgen hatte. Für uns vier Geschwister jedenfalls blieb durch den Existenzkampf meiner Eltern wenig Zuneigung und Liebe übrig. Oder besser: Sie wurde uns nicht so offenbart, wie es uns gutgetan hätte.
Nun wohnten wir also in der Erphostraße, einer recht noblen Gegend in Münster. Wir teilten die Wohnung mit einer weiteren Mieterin. Im Winter blühten die Eisblumen an den Fensterscheiben, weil sich der Kachelofen vergeblich mühte, Wärme bis unter die hohen Stuckdecken zu verteilen. Die unfreundliche Vermieterin ließ uns nicht in den Garten hinter dem Haus. Dafür schüttelte sie ihre Betten gern genau dann aus dem Fenster aus, wenn meine Mutter unseren jüngsten Bruder im Kinderwagen an die frische Luft vor die Tür geschoben hatte. Auf der anderen Straßenseite lebten gut situierte Nachbarn in schönen Häusern mit gediegener Einrichtung und so etwas wie Musikzimmern. Dass auf uns herabgeschaut wurde, störte mich nicht, wohl aber die genauso prompten wie falschen Schuldzuweisungen an uns bei den Resultaten schief gegangener Kinderstreiche.
Meine Mutter sehe ich in meiner Erinnerung unermüdlich arbeiten. Sie nähte und strickte für uns vier Kinder alles. Auf alten Fotografien sieht man uns vier wie aus dem Ei gepellten Kindern die Armut nicht an. Wir stecken in exakt passenden Wintermäntelchen mit entsprechenden Strickmützen auf akkuraten Haarschnitten. Hosen und Kleider saßen wie angegossen, wir machten einen äußerst ordentlichen Eindruck. Zum großen Kummer meiner Mutter entsprach ich ganz und gar nicht diesem Eindruck. Da sie selbst eher Plattdeutsch sprach und kaum Schulbildung genießen durfte, hatte sie kein allzu großes Selbstbewusstsein entwickelt. Umso anstrengender empfand sie ein Kind, das sich einfach nicht einfügen mochte. Ich stellte unentwegt Fragen und muss der geforderten Frau oft genug provokant vorgekommen sein. Vielleicht hätte sie mit mehr Bildung und Selbstbewusstsein mein Potenzial erkannt und es gewürdigt. So aber war mein Verhalten eine Last für sie. Sie schämte sich für mich und ließ mich das oft genug wissen. Mein Anderssein kommentierte sie mit „Du bist für nichts gut. Eine Nichtskönnerin.“ Sie war streng und verhielt sich mir gegenüber abweisend. Mit meiner Übersensibilität fühlte ich ihre Not (nicht nur) mit mir und versuchte, ihr alles recht zu machen. Ja, ich tat geradezu vorauseilend Dinge, die sie erfreuen würden. Dass sie mit ihrer Strenge und Härte versuchte, mich „irgendwie in die Spur“ zu bekommen, war für damalige Erziehungsmethoden nicht ungewöhnlich. Wie sehr sie trotzdem zu mir hielt, merkte ich dann, wenn mir jemand Leiden zufügte oder ich traurig war, weil mir etwas misslang. Dann machte mir meine Mutter Mut, baute mich auf, appellierte an meine Courage. Spirituell betrachtet weiß ich heute, dass meine Mutter mit ihrem Verhalten ihren Auftrag an mir erfüllte, indem sie mich ihre Ablehnung manchmal so bitter spüren ließ. Diejenigen im Leben, die uns wie die größten Kontrahenten erscheinen, sind unsere besten Lehrmeister. Sie haben diese Rolle übernommen, damit wir innerlich an der Auseinandersetzung reifen können und unseren Weg finden. Jeder kennt die Schwierigkeiten von Menschen, die stets vorsorglich in Watte gepackt wurden. Ich bin meiner Mutter nicht nur aus dieser Erkenntnis heraus dankbar, sondern wir haben mittlerweile sogar ein ganz inniges, liebevolles Verhältnis miteinander, über das wir beide sehr glücklich
sind.
Diese versöhnliche Haltung habe ich auch gegenüber meinem Vater, dessen ganzes Wesen meinem so ähnlich war. Aber ihn hat das harte Schicksal gelehrt, Gefühle nicht zu zeigen. Obwohl ich also um unseren Gleichklang in der Zartheit der Wahrnehmungsfähigkeit wusste, wurde mir auch von seiner Seite kein liebevolles Miteinander zuteil. Sehr wohl war er aber im Gegensatz zu meiner Mutter stolz auf mich und erkannte etwas in mir, das sich anderen nicht offenbarte. Bis zu seinem Tod blieb er für mich geheimnisumwoben und unnahbar, und bis zu seinem Tod sehnte ich mich nach einer Umarmung von ihm und eine Bekundung seiner Vaterliebe. Er konnte es nicht.
Wir Geschwister kamen in den St. Mauritz-Kindergarten. Der weihevolle Name änderte nichts an der Tatsache, dass wir damals dort geschlagen wurden. Die kriegserschütterten Erwachsenen in meinem Umfeld schafften es noch nicht einmal, ihre weichen Seiten im Umgang mit Kindern wieder zuzulassen. In der Schule warfen verhärmte Lehrer später gezielt mit Schlüsselbunden.
Als ein Pfarrer bei einer Führung durch die St. Mauritzkirche fragte, warum eine der Steinfiguren dort die Lilie so besonders hochhalte, erhielt ich auf meine unschuldige Kinderantwort hin, dass er so besser an ihr riechen könne, eine schallende Backpfeife. Durch die ersten fünf Jahre meines eher von trüben Bildern geprägten Kinderlebens hatte ich mich hindurchgekränkelt. „Die will nur Aufmerksamkeit erheischen“, hieß es in der entfernteren Familie. Weiteres Salz in den Wunden meiner Mutter. Neben Lungen- und Mittelohrentzündungen litt ich an einer Fehlstellung meiner Beine und musste täglich zwei Stunden in Metallschienen im Bett liegen. Inmitten dieser trostlosen Alltagsatmosphäre verhinderte zudem meine Sensibilität jegliche Form von Unbeschwertheit. Die mich umgebenden Schwingungen der anderen erzählten mir unentwegt von deren Sehnsüchten und Traurigkeiten. Wo sich andere Kinder im Urvertrauen befanden, dass Erwachsene schon alles regeln würden, spürte ich, dass auch Erwachsene an ihre Grenzen kamen und überfordert waren. Ich fühlte tief verunsichert, dass uns der viel zu sensible und belastete Vater verlassen wollte. Ein Entschluss, den er dann doch verwarf. Bis heute bin ich ihm dankbar, dass er sein Vorhaben fallen ließ. Wir wären als Kinder einer mittellosen Mutter in ein Heim gekommen. Auch fühlte ich eine Todessehnsucht in ihm, die mich bedrückte. Ich wollte keine Last sein und die Existenznöte mittragen helfen. Schuhe und Schulbücher für vier Kinder waren teuer, da half auch die ewige Brotsuppe nicht beim Sparen. Ohne mir wirklich dessen bewusst zu sein, aß ich nur noch Haferflocken, um meinen Geschwistern nichts wegzunehmen, und wurde spindeldürr.
Allerdings bin ich recht häufig Auto gefahren, und zwar jedes Mal dann, wenn die Polizei mich wieder nach Hause zurückbrachte, nachdem sie mich irgendwo aufgegriffen hatte. Warum ich ständig weglief? Aus für mich völlig rationalen Gründen. Ich fühlte mich wie eine Außerirdische und war der festen Überzeugung, nicht bei meinen richtigen Eltern zu sein. Das teilte ich ihnen auch mit, was sich nachteilig auf meinen Sympathiewert auswirkte. Ich lief wie Hänschen klein einfach los und hoffte, in die Welt hinein zu finden, in die ich mich innerlich immer flüchtete. Irgendwo musste ich doch ein wahres Zuhause haben! Lange Jahre habe ich, wenn mich jemand auf meine Kindheit angesprochen hat, mein damaliges Erleben beschrieben mit „als ob ich in einer großen Blase stecken würde“. Ich erlebte und betrachtete alles wie aus einem unsichtbaren Kokon heraus. Erst jetzt, während der Arbeit an diesem Buch, erfuhr ich endlich in einer Meditation, was es mit dieser „Blase“ auf sich hatte. Die ganze Zeit über hatte ich mich in der Aura meines Geistführers befunden, mit der er mich beschützt hatte.
Meine Patentante brachte mich einmal nach einem Besuch bei ihr wesentlich früher als geplant und völlig frustriert zu meinen Eltern zurück. Sie wollte der kleinen Nichte einen schönen Tag bereiten, wie liebe Patentanten es gemeinhin mit Eis und Plaudereien und einem Spielplatzbesuch tun. Aber sie verzweifelte an dem Kind, das da stumm und traurig aus dem Fenster starrte. Möglicherweise habe ich mich mit Gott unterhalten, aber nicht mit ihr. Ich war realitätsfremd, introvertiert, schwierig und auffällig, dazu viel zu dünn. Alice in Wonderland mit einem unsichtbaren Ägypter an ihrer Seite. Zu meinem Entsetzen sollte eine sogenannte „Kinderverschickung“ Abhilfe schaffen.
Während sich viele Kinder üblicherweise nach dem Abschied von den Eltern auf den Freizeitspaß mit anderen freuen, erleben hochbegabte, sensible Kinder das oft genug als Grauen. Lauter kleine, laute Mitmenschen, die sich bestens verstehen und im Leben auskennen, während man selbst keinen Zugang findet und sich darüber wundert, welche Banalitäten den Altersgenossen zur Zufriedenheit reichen. Ich hatte Heimweh, sogar nach meinen „nicht richtigen“ Eltern, und nach meinem vertrauten Bett. Ob das Bett im Schlafsaal nicht auch ganz tröstlich und gemütlich war, entzog sich meiner Beurteilung. Ich lag nachts mit einer Decke nicht in ihm, sondern unter ihm, weil ich mich meines Daumenlutschens schämte und nicht wollte, dass es jemand sah.
Eines schnöden Kurtages hatte jemand einen toten Fuchs gefunden, den es aufwändig zu beerdigen galt. So eine Beerdigung fand ich mal ziemlich interessant und war mit dabei, als alle in den Wald liefen. Wie immer leicht abwesend schaute ich in die Wipfel der mächtigen Tannen und erblickte eine Zwergengestalt. Diese Entdeckung teilte ich in euphorischer Aufregung meinem Umfeld mit. Die Kinder nahmen meine ungewöhnliche Information je nach Alter gelassen bis gnädig hin und widmeten sich wieder der Bestattung des Fuchses. Die Betreuerinnen aber vertieften mit ihrer Reaktion mein Misstrauen und meine Zweifel gegenüber der Erwachsenenwelt. Sie fuhren mir mit Geschimpfe über den Kindermund. Wie man nur so einen Unsinn erzählen könne? Was das für eine dumme Lüge sei, Zwerge gäbe es schließlich nicht. Ich schwieg mit ausdrucksloser Miene, aber vor meinem inneren Auge sah ich all die von Erwachsenen für Kinder geschriebenen Bücher mit Zwergengeschichten. Wer log denn da und erzählte Unsinn? Noch heute denke ich beeindruckt an die Erscheinung dieses Erdgeistes, die mich lehrte, jeder Wesenheit mit Respekt zu begegnen.
Auch diesen Respekt hat unsere Kultur so gründlich verlernt, dass wir noch nicht einmal unseren Kindern gestatten, ihren Wahrnehmungen Glauben zu schenken. Während in anderen Kulturen und Naturreligionen selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass Geister die Elemente beleben und über Flora und Fauna wachen, sind deren symbolische Vertreter wie Elfen, Zwerge, Kobolde, Nixen in der modernen Gesellschaft zu Kinderbuchgestalten degradiert worden. Wer sie „sieht“, dem wird als Kind eine blühende Fantasie bescheinigt. Als Erwachsener erhält man für Wahrnehmungen dieser Art allenfalls eine Bescheinigung zur Kostenübernahme durch die Krankenkasse für die Behandlung von Wahnvorstellungen. Bei den Griechen und Römern durften Erwachsene völlig unverdächtig an Gottheiten der Ozeane, der Flüsse, der Erde, des Windes, des Regenbogens oder des Waldes glauben. Diese Wesenheiten hatten Namen und man zollte ihnen Respekt, indem man achtsam mit der Natur umging. Nun sind sie in der heutigen Zeit zu Fabelwesen verkommen. Wozu die mangelnde Ehrfurcht des technik- und fortschrittgläubigen Menschen unserer Zeit geführt hat, sieht man an unserem ausbeuterischen Umgang mit den Ressourcen und Naturwundern unseres Heimatplaneten. Niemand glaubt mehr an die Rache der Baumgeister, wenn wir den Regenwald erbarmungslos roden. Treffen wird sie uns trotzdem.
Mein nicht enden wollender Appell an alle, die mit Kindern leben: Nehmen Sie alle jungen Menschen, und vor allem die besonders schwierigen, „irgendwie anders gearteten“ Kinder bitte ernst in ihren Wahrnehmungen und Gefühlen. Ziehen Sie doch bitte in Erwägung, dass die Kinder, die als defizitär abgestempelt werden, weil sie nicht in die gesellschaftlich festgelegte Funktionsschablone passen, sogar zu mehr in der Lage sind, als alle anderen. Nur weil Sie als Erwachsener Ihr Umfeld weniger vielschichtig erleben, heißt es nicht, dass Ihre Wahrnehmung richtiger ist. Aus spiritueller Sicht haben sich in diesen besonderen Kindern sehr alte Seelen reinkarniert, um noch weitere Erfahrungen zu machen. Und jeder Erwachsene, der merkt, dass das Kind vor ihm bald mehr Weisheit hat, als er selbst, ist schon ziemlich nah dran. Machen Sie sich doch selbst die Freude, Ihr eigenes Erleben nicht als absolut zu setzen. Bleiben Sie neugierig, und lassen Sie sich von der kleinen Hand einmal in Welten führen, von deren Existenz Sie nichts ahnen. Falls Ihnen dadurch der Glaube an Gott und Engel sowie die Achtung vor dem Unerklärlichen und das Staunen über Gottes Werk in der Natur (wieder) geschenkt wird – wie wunderbar! Demut tut dringend not. Auch meine eigene wunde Kinderseele fand Frieden in der Natur.
Zu früh wurde ich mit fünf Jahren in die St. Mauritzgrundschule eingeschult und damit den aus russischer Gefangenschaft wiedergekehrten Lehrern ausgeliefert. Für deren psychische Verfassung habe ich grundsätzlich Verständnis, aber für kleine Kinder bleibt die daraus resultierende Verhaltensweise selbst nicht ohne psychische Folgen. „Pädagogik“ von damals wurde zur Erfahrung von Übergriffen und Gewalt und Herabwürdigung. Die rettenden wundervollen Auszeiten im Grünen hatte ich meinem Vater zu verdanken.
Im Gegensatz zu vielen anderen Vätern, die ihre eigenen unverarbeiteten Erlebnisse damals durch entsprechend unbeteiligtes oder strenges Verhalten an ihre Kinder weitergaben, wollte unser Vater eine glückliche Kindheit für seinen Nachwuchs. Was er an Gefühlen nicht zeigen konnte, versuchte er durch Gaben auszudrücken. Ungeachtet der finanziellen Lage kaufte er uns alles. Bis heute habe ich keine Ahnung, wie er es bewerkstelligte, aber sogar ein Ferienhaus im sauerländischen Huxol bei Brilon-Bontkirchen wurde gebaut. Wenn es überhaupt Kindheitserinnerungen gibt, in denen ich so richtig schwelgen kann, dann sind es die von Wochenenden und Ferien im Haus in Brilon. Auch wenn wir es nicht ganz für uns hatten, denn auf Mieteinnahmen haben unsere Eltern natürlich nicht verzichtet. Hier war die Familie gelöst und entspannt. Wir gingen singend durch den Wald, tobten und lachten. Die Eltern hatten ihre Sorgen in Münster gelassen, wir Kinder genossen den Ausnahmezustand in der Freiheit. Zur fröhlichen Atmosphäre dort gehörte ein gutmütiger Landwirt, der Spaß daran hatte, uns Kinder während unserer Stippvisiten mit allerlei Sprüchen zu necken. Kuh Alma wurde uns als Testerin für die gesammelten Pilze angeboten, denn wenn sie alles auffräße, seien die Pilze essbar. Tiere gehörten zu Brilon. Es gab einen für seinen Wachdienst viel zu freundlichen Hund, und ich teilte mein Bett genauso großzügig wie heimlich mit aufgelesenen Eidechsen.
Auch im Sauerland zog ich oft die Einsamkeit vor. Es gab keine elterlichen Bedenken, uns unter bestimmten Vorgaben allein in den Wald zu lassen, und so genoss ich die beruhigende Zeit am klaren Bach, lauschte seinen plätschernden Geschichten und baute Mooshäuser. Im Sirren der wiegenden Gräser und im sanften Rauschen der Blätter vernahm ich Stimmen, die mir kleinem Menschenkind mit ihren Offenbarungen höherer Zusammenhänge viel zumuteten. Viel anfangen konnte ich damit nicht. Heute weiß ich, dass es zu meiner Vorbereitung gehörte.
Dem Alltag war ich weiterhin nicht gewachsen. Mein Gefühl des kompletten Versagens gegenüber den äußeren Ansprüchen und meine innere Einsamkeit zogen sich schleppend auch durch die weiteren Schuljahre. Ich galt als renitent und schwierig, weil ich mich verweigerte und Dinge äußerte, die man einem Kind nicht zutraute. Ich litt, fühlte mich fremd und nutzlos, und irgendwann verstummte ich konsequenterweise. So saß ich – für damalige Zeiten eine Seltenheit, was muss dieser Schritt für meine Eltern bedeutet haben! – eines Tages vor einem Psychologen. Rückblickend kann ich aus meiner heutigen Erfahrung sagen, dass dieser Mann Einfühlungsvermögen und Fachkenntnis besaß und erkannte, in welcher Seelennot ich steckte. Er schaute meinen Vater ernst an und sagte recht eindringlich: „Wenn Sie sich Ihrer Tochter gegenüber nicht anders verhalten, werden Sie es später einmal sehr bereuen.“ Aber wo sollten meine Eltern eine andere Einstellung und vor allem Verständnis für mich hernehmen? Es gab also keine Änderung mir gegenüber, und die unschöne Prognose des Psychologen nahm in meiner weiteren Entwicklung zur Jugendlichen tatsächlich Fahrt auf.
Kapitel 2
Als ich 14 Jahre alt war, verlor ich das Refugium in Brilon. Eines Tages rief Vater uns noch vor dem mittäglichen Eintopf im Wohnzimmer zusammen und erklärte, dass die finanzielle Lage ihn zum Verkauf unseres Feriendomizils in der erholsamen Natur zwänge. Da mir bis heute grundsätzlich ein Rätsel ist, mit welchen Mitteln er es hatte bauen und halten können, war diese Entwicklung für uns schmerzhaft, aber im Nachhinein natürlich nicht überraschend. Dass ich mittlerweile mit meiner Familie auch in Münster in einem eigenen Haus wohnte, konnte mich über den Verlust im Sauerland nicht hinwegtrösten. Die Wohnungsgesellschaft Deutsches Heim hatte günstiges Bauland und gute Konditionen für nicht so begüterte Familien in Münsters Stadtteil Coerde angeboten. Zudem erhielten kinderreiche Ehepaare Zuschüsse. Meine Eltern griffen zu. Schweigen wir aus Höflichkeit gegenüber den Träumen meiner Eltern lieber darüber, ob das Haus, das da entstanden war, in irgendeiner Weise als schön bezeichnet werden konnte. Ich fand es grau und kastig und zu eng und schmucklos. Aber es hatte einen Garten, der nur uns gehörte. Bislang hatten wir in den Resttrümmern des zerbombten Münsters gespielt. Hausruinen und Straßenstaub dienten als Kulisse und Bühne für Kinderaktivitäten. Als ich mit 14 Jahren meine Puppe im eigenen Garten auf das Fleckchen Rasen setzte, das sich auf dem Mutterboden am Rohbau ausbreitete, rief meine Mutter erstaunt: „Bist du dafür nicht schon zu alt? Seit wann spielst du wieder mit Puppen?“ Ich schaute auf meine Puppe und rief zurück: „Einfach, weil ich sie jetzt endlich mal ins Gras setzen kann!“
Die Bauphase bedeutete für Vater und Mutter eine erneute Belastung, die ihnen Zeit für uns Kinder raubte. Trotzdem haben sie bei aller Arbeit, Sorge und kleinem Portemonnaie viel gefeiert. Sie hatten durch den Krieg erfahren, was der Verlust eines Alltags in Frieden bedeutet und lebten die Erleichterung und keimende Lebensfreude, wo immer es sich bot. Weniges genügte, um einen Namenstag oder ein anderes Ereignis gebührend zu feiern. Etwas Limonade, erschwingliches Bier, gestreckte Frikadellen und Musik – selbst meine eher bedrückte Mutter tanzte ausgelassen ihren Sorgen davon.
> Diese Leseprobe als PDF laden
> Dieses Buch direkt beim Verlag bestellen
Kundenrezensionen
Für das Buch "Hallo Jenseits, ich bin online" liegen bei amazon 211 Kundenrezensionen mit einer Bewertung von 4,5 von 5 Sternen vor (Stand 15.12.2022).


